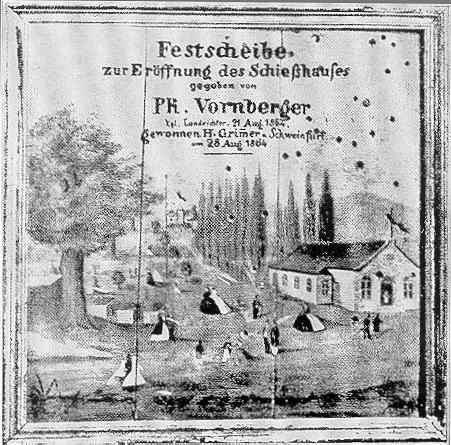
|
Schützen-Festscheibe aus dem
Jahre 1864, erinnert an die Eröffnung des neuen Schießhauses.
|
Berichtet man aber von Schützenfesten, ist es unerlässlich,
auch von dem eigentlichen Kern eines jeden Schützenfestes, dem Schießen,
einen Eindruck zu vermitteln.
Die Einlage für das Schießen bestand aus einem Gulden und
dreißig Kreuzern (1 fl 30 kr) für das Los. Alle Gattungen gezogener Büchsen
und Standrohre waren zugelassen. Bis zum Aufkommen der Freischießen wurde
mit aufgelegtem Gewehr geschossen. Die Büchsen waren Vorderlader. Eigene
Ladetische, an denen nicht geraucht werden durfte, waren außerhalb der
Schießstände aufgestellt. Dort wurden zuerst die Zündhütchen in die Gewehre
eingesetzt, und dann maß man das notwendige Quantum Pulver mit dem Pulvermaß
ab, das nach der Entfernung, auf welche geschossen wurde, abgestimmt war.
Dieses Pulvermaß war ein kleines röhrenförmiges Gefäß aus Messing, das
mit einer Stricheinteilung und einem verschiebbaren Boden versehen war;
je weniger Pulver für den beabsichtigten Schuss benötigt war, desto höher
wurde der Boden des Pulvermaßes geschoben. Wenn das Pulver in den Lauf
geschüttet war, wurde ein Propfen aus Leinen nachgeschoben und die eingefettete
Kugel in den Lauf gebracht. Sie musste nun mit dem Ladestock so lange
nach unten gestoßen werden, bis beim Stoßen kein hohler Klang mehr zu
hören war und der Ladestock leicht zurücksprang. Das war das Zeichen,
dass die Kugel auf dem Boden fest aufsaß.
Es gab damals nur zwei Schießstände. Sie waren vollständig
abgeschlossen, damit der Schütze ungestört seinen Schuss abgeben konnte.
Nur ein kleines, rundes Glasfenster in der Türe ermöglichte einen Einblick
in den Stand. Nach jedem Schuss musste der „Schießgeselle" den
Stand verlassen und einem anderen Schützen Platz machen, da das oben beschriebene
Laden der Büchse eine längere Zeit in Anspruch nahm.
Die Scheiben waren dreiteilig und nur „Dreier"-
und „Zentrum"-Treffer wurden gewertet. Im Mittelpunkt der Scheibe,
die unbeweglich war, befand sich ein Rohr. Gelangte die Kugel in das Zentrum
und damit in das Rohr, wurde ein Mechanismus ausgelöst, der eine Figur,
einen Bajazzo, hochschnellen ließ. War das Zentrum einmal von einem Schützen
getroffen worden, wurde das Schießen eingestellt und eine Kommission begab
sich an den Schützenstand, um festzustellen, ob es damit seine Richtigkeit
habe. War dies der Fall, wurde der Schütze vom Scheibenstand zum Schießhaus
geführt, die Musik und die Zieler begleiteten ihn, und die Festbesucher
jubelten.
Das ganze Schießen wurde von den Schützenmeistern und Kleinodienmeistern
beaufsichtigt und geleitet. Da man eine so anstrengende Tätigkeit nicht
umsonst verlangen konnte, hatten die Schützenmeister das „Zuckerwasser",
das sie während des Schützenfestes tranken, frei. Der Genus von Bier war
ihnen bei der Durchführung ihres schweren Amtes nicht gestattet.5)
Der Erste Weltkrieg beendete für mehr als vier Jahre jede
praktische Tätigkeit der Schützengesellschaft, und auch auf die Durchführung
der Schützenfeste musste in den Jahren 1915 - 1918 verzichtet werden.
Am 3. August 1919 konnte nach fünfjähriger Pause erstmals
wieder das „Freischießen" durchgeführt werden, allerdings nur
drei Tage lang. Das „Tagblatt" schrieb damals: „Es war
das altgewohnte, anmutige, so viele Jahre vermisste Bild, dass der Festzug
sich unter den Klängen der Bamberger Militärmusik und unter Teilnahme
der eingeladenen Vereine nach dem Schießanger bewegte; doch war etwas
anders wie sonst. Die Zeiten haben sich geändert und auch die Menschen.
Die reine Festesfreude und Stimmung kam nicht zum Durchbruch."6)
Die Schützenfeste von 1921, 1922 und 1923 standen im Zeichen
der Inflation. Das Treiben auf dem Festplatz verlief wie in früheren Zeiten,
aber man musste jetzt mit Zehntausendmarkscheinen Dinge bezahlen, die
man früher für zehn Pfennig erhielt.7)
Am 20. September 1925 konnte die Scharfschützengesellschaft
eine seltene Ehrung begehen: Ehrenschützenmeister Kommerzienrat Krauss
feierte das Goldene Schützenjubiläum. Mit herzlichen Worten wurden die
hohen Verdienste des Jubilars um die Schützensache hervorgehoben. Anlässlich
seiner 50jährigen Mitgliedschaft bei der Schützengesellschaft wurde er
zum Ehrenschützenmeister des Oberfränkischen Schützenbundes ernannt und
zugleich wurde ihm die Ehrenschleife des Verbandes (Prinz-Alfons-Erinnerungszeichen)
überreicht. 8)
Mit der Machtübernahme durch Hitler brachte das Jahr 1933
die Gleichschaltung der Gesellschaft im Sinne der Richtlinien der Nationalsozialistischen
Deutschen Arbeiterpartei. Ein Versuch, sich diesem Eingriff nach Möglichkeit
zu entziehen, blieb erfolglos. Doch am 4. 3. 1933 lehnte die Schützengesellschaft
die offizielle Teilnahme an der von der NSDAP veranstalteten öffentlichen
Kundgebung noch mit der Begründung ab: „Wir haben uns in dieser Sache
an den Deutschen Schützenbund gewandt und von daher die Weisung erhalten,
dass unsere auf vaterländischem Boden stehenden Schützenvereine sich nur
dann an derartigen Veranstaltungen beteiligen sollen, wenn dazu von der
Regierung selbst oder von der Gesamtheit der vaterländischen Verbände
aufgerufen wird."9)
Am 17. November fand die entscheidende Generalversammlung
im Schützenhaus statt. Die vom Führer des Deutschen Schützenbundes für
die Neugestaltung der Schützengesellschaften herausgegebenen Richtlinien
und Vorschriften wurden bekannt gegeben. Für die Gesellschaft war bisher
die Bayerische Schützenordnung von 1868 gültig gewesen. Die neuen Satzungen
waren in der Hauptsache auf die Durchführung des Führerprinzips ausgerichtet.
Sie bestimmten, dass nur noch der Führer, sein Stellvertreter und zwei
Kassenprüfer gewählt wurden, während die Beiräte und Mitarbeiter vom Führer
bestimmt wurden.
Gegen die Beibehaltung des bisherigen Namens war vom Deutschen
Schützenbund nichts eingewendet worden. Da jedoch das königliche Privilegium
durch die neuen Verhältnisse praktisch unwirksam wurde, beschloss die
Versammlung, das „königlich" wegzulassen und den Namen „Privilegierte
Scharfschützen-Gesellschaft Lichtenfels" zu führen. Udo Krauss wurde
einstimmig zum Führer der Gesellschaft gewählt.10)
In der zweiten Julihälfte 1939 konnte, nur wenige Wochen
vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges, das Schützenfest in vollem Glanz
noch einmal durchgeführt werden. Zum Kinderfest waren auch die Schulen
der Nachbarorte Trieb, Seubelsdorf, Kösten, Schney und Mistelfeld eingeladen.
Jede Klasse beteiligte sich mit einigen Gruppen.11) Während des
Krieges fanden Schützenfeste nicht mehr statt, doch die Schießübungen
wurden in beschränktem Umfang weitergeführt.12) Als Ersatz wurden
1942 Kriegsschießen veranstaltet, an denen auch benachbarte Schützengesellschaften
teilnahmen, und 1944 konnte nochmals ein SA-Wehrschießen abgehalten werden.13)
Als der Krieg seinem Ende entgegenging, bestand die Privilegierte
Scharfschützengesellschaft nicht mehr; ohne rechtliche Vertretung war
sie aufgelöst.
|